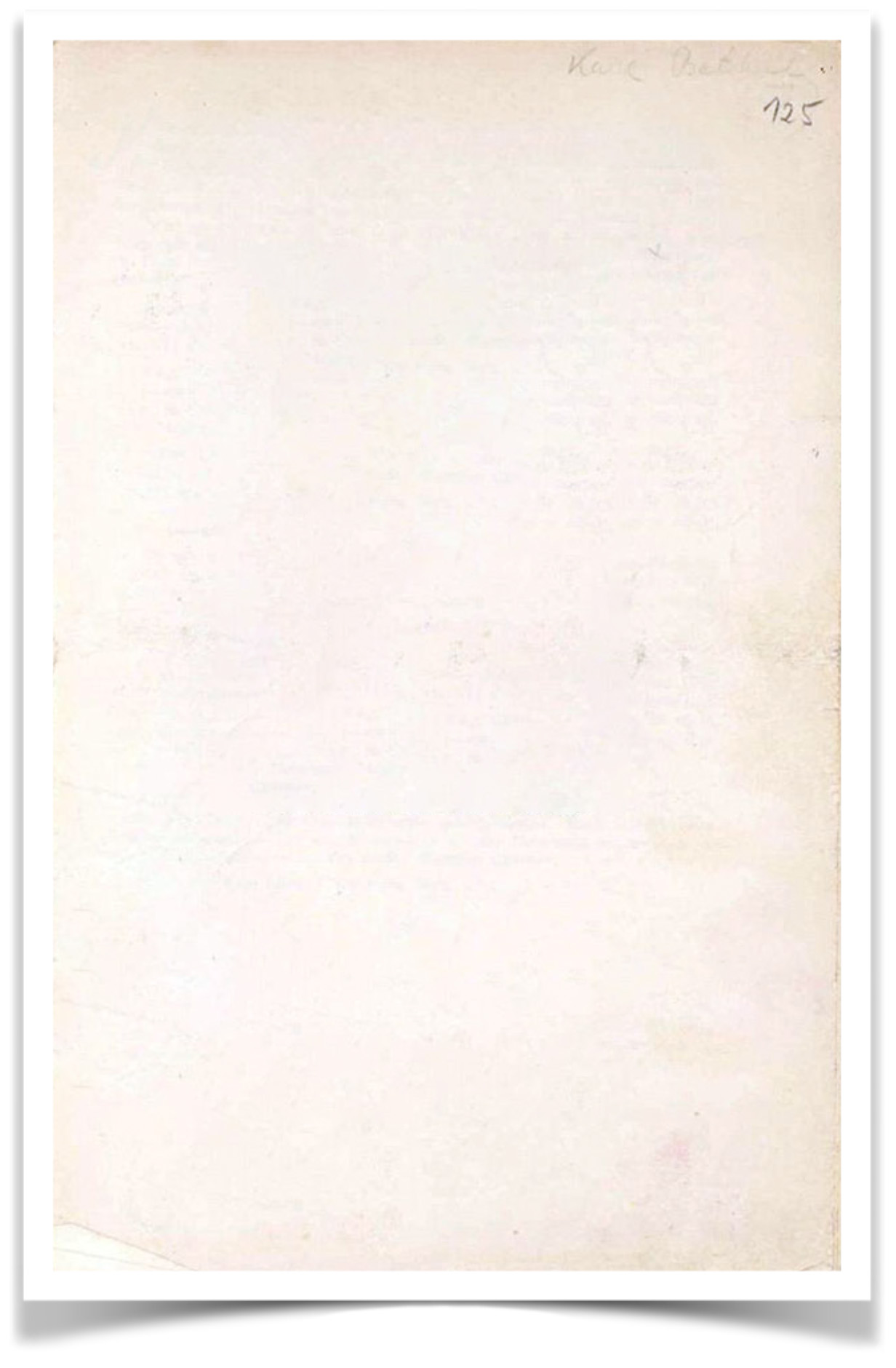Lilo Verhörprotokolle (Audiodeskription)
Eine statische Kameraeinstellung zeigt eine Frau, die auf einer hohen Mauer sitzt. Ihre Beine hängen locker über den Rand, die Füße baumeln frei. Die Hände ruhen kraftlos im Schoß. Ihr Blick ist ernst, wandert langsam von einer Seite zur anderen, als würde sie etwas in der Ferne beobachten. Auf der Stirn treten Runzeln hervor, zwischen den Augenbrauen bilden sich tiefe Falten. Es ist ein Ausdruck von konzentriertem Nachdenken, von Grübeln und innerem Ringen. Das Heben und Senken ihrer Schultern verraten ein schweres, tiefes Atmen. Die Lippen sind schmal aufeinandergepresst, die Augen leicht zusammengekniffen, dem grellen Sonnenlicht entgegen gereckt.
Das helle Licht lässt ihr rötliches Haar aufleuchten. Es ist locker gescheitelt und hochgesteckt. Sie trägt eine weiße, kurzärmelige Bluse mit schwarzer Krawatte. Ein dunkler, plissierter Rock reicht bis zu den Knien. An den Füßen trägt sie Schnürschuhe, dazu helle Strümpfe. Eine schmale Nickelbrille rahmt ihr Gesicht.
Die Frau ist die Stuttgarter Choreografin Nina Kurzeja. In Kostüm und Maske der 1930er Jahre verkörpert sie hier die kommunistische Widerstandskämpferin Liselotte Herrmann. Herrmann wurde im Juni 1938 vom nationalsozialistischen Volksgerichtshof in Stuttgart zum Tode verurteilt – als erste Frau im Widerstand gegen das NS-Regime.
Das ursprüngliche Justizgebäude, in dessen Lichthof die Urteilsverkündung erfolgte, befand sich unweit des heutigen Standorts des Landgerichts Stuttgart. Dieses erhebt sich im Hintergrund der Szene, seine Fassade ragt hinter Kurzeja in die Höhe. Vor dem Gebäude stehen drei Aluminium-Fahnenmasten, weiter links der Eingang des Landgerichts. Im Gegenlicht schimmern drei tafelartige Stelen aus dunklem Metall. Sie tragen in enger weißer Schrift die Namen von 423 Menschen, die hier in der NS-Zeit hingerichtet wurden. Die Stelen gehören zur Dauerausstellung „NS-Justiz in Stuttgart" im ersten Stock des Gerichts.
Nun tritt die Mauer, auf der Kurzeja sitzt, deutlicher ins Blickfeld. Es ist die mannshohe Begrenzungsmauer neben dem Treppenaufgang des Vorplatzes. Direkt unterhalb der Mauerkrone, teils verdeckt durch ihre Beine, verläuft ein schmales Band aus rotem Sandstein mit einer eingemeißelten Inschrift: „Den Opfern der Justiz im Nationalsozialismus zum Gedenken – Hunderte wurden hier im Innenhof hingerichtet – Den Lebenden zur Mahnung." Dieses Denkmal wurde 1994 eingeweiht.
Ein Schnitt: Nun steht Kurzeja, in der Rolle Herrmanns, auf dem Vorplatz des Landgerichts. In den Armen hält sie einen Säugling, fest in ein Tuch gewickelt – ihren Sohn Walter. Die Kamera zeigt sie leicht von unten, während sie in sanft wiegendem Schritt vor dem Gebäude steht. Mit beiden Armen hält sie das Kind dicht an sich gedrückt, lächelt und spricht ihm leise zu. Links im Hintergrund liegt der Eingang des Landgerichts, rechts erhebt sich die Verfassungssäule vor der Fassade.
Ein weiterer Schnitt: Die Eingangssequenz wiederholt sich. Kurzeja sitzt wieder allein auf der Mauer. Die Augen sind wegen der Sonne gelegentlich geschlossen, das schwere Atmen wird sichtbar am Heben und Senken der Schultern. Sie verharrt nahezu regungslos.
Noch ein Wechsel: Erneut steht sie mit dem Kind auf dem Vorplatz, das Gebäude hoch in ihrem Rücken. Die Kamera bleibt unbewegt, zeigt im Wechsel diese beiden Perspektiven – sitzend auf der Mauer, stehend mit dem Säugling im Arm.
Zum Schluss verdunkelt sich das Bild langsam. Die Szene blendet in tiefes Schwarz aus.